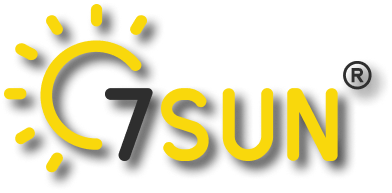Die Energiesystemtransformation in der Schweiz befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Ein charakteristisches Merkmal ist der zunehmende Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Heute sind Photovoltaik-Kleinkraftwerke auf den Dächern von Wohngebäuden, Firmensitzen und in etwas größerem Umfang auch auf Brachflächen, Wiesen oder sogar Gewässern zu finden. Die sichere Nutzung dieser Systeme ist nur gewährleistet, wenn zwei Hauptfaktoren beachtet werden: eine Installation gemäß den Branchenstandards und die Verwendung zertifizierter Materialien. Diese Aspekte betrachten wir im folgenden Artikel.
Risikobewertung von PV-Anlagen
Ein wesentlicher Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit von Photovoltaikanlagen ist die Identifizierung potenzieller Risiken. Installateure und Investoren sollten verschiedene Gefahrenquellen sowie Methoden zur Minimierung ihrer Auswirkungen in Betracht ziehen. Besonders zu beachten sind folgende Aspekte:
- Brandrisiko – PV-Anlagen befinden sich oft auf Dächern, was ein potenzielles Brandrisiko darstellt.
- Zertifizierung der Komponenten – Wie unterscheidet man sichere Materialien von solchen, die ein Risiko für die gesamte Anlage darstellen? Zertifikate sind hier entscheidend!
- Elektrische Gefahren – Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, wodurch Risiken wie elektrische Schäge, Überspannung oder Kurzschlüsse auftreten können.
- Konstruktive Aspekte – Das Gewicht der PV-Anlage kann die Tragstruktur des Gebäudes, insbesondere des Dachs, beeinflussen.
Brandgefahr bei PV-Anlagen
Kann eine Photovoltaikanlage einen Brand verursachen? Ja, wenn sie nicht fachgerecht installiert wurde. Die häufigsten Ursachen für Brände in PV-Anlagen sind:
- Wetterbedingte Einflüsse (z. B. Gewitter)
- Montagefehler (insbesondere in Bezug auf Steckverbinder, Kabel und Schnellanschlüsse)
- Defekte Komponenten ohne ausreichende Belüftung
- Fehlerhafte Planungsannahmen (z. B. falsche Kabelquerschnitte)
- Fehlende Wartung
Die Planung von PV-Anlagen sollte unter Einhaltung zahlreicher Normen erfolgen, darunter SN EN 62852, SN EN 61439-2 sowie SN EN 50565-1. Die Installation muss von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Zudem empfiehlt es sich, die Richtlinien des «Stand-der-Technik-Papier (STP) von Swissolar» zu beachten, insbesondere:
- Berücksichtigung der Gebäudekonstruktion und Brandschutzvorkehrungen
- Verwendung von DC-Verbindungen mit Steckverbindern desselben Typs und Herstellers
- Minimierung der Anzahl von DC-Verbindungen
- Verlegung von Kabeln in metallenen Kabelkanälen zur Reduktion scharfer Kanten
- Kennzeichnung von Installationskomponenten gemäß SN EN 60364-7-712
- Kennzeichnung von Kabeltrassen
- Platzierung eines Pulverfeuerlöschers in der Nähe des Wechselrichters
Auch die Qualität der verwendeten Materialien beeinflusst die Brandsicherheit maßgeblich.
Zertifizierung von PV-Komponenten
Die Wahl der Materialien sollte mit Bedacht erfolgen. Insbesondere die Module müssen bestimmte Kennzeichnungen aufweisen. Sie sollten uneingeschränkt mit der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU konform sein und eine Reihe harmonisierter und nicht harmonisierter Normen erfüllen, darunter:
- EN IEC 61730-1, EN IEC 61730-2
- EN IEC 61215-1:2021, SN EN IEC 61215:2017
Zur Gewährleistung der Brandsicherheit sind insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschocks und Feuchtigkeit wichtig. Diese Eigenschaften werden durch Temperaturwechseltests (TC) sowie Feuchte-Wärme-Tests (DH) geprüft. Führende Hersteller wie LONGI, Jinko Tiger, Trina Solar, Ja Solar, Canadian Solar und Q-Cells bieten entsprechend geprüfte Module an. Bei der Auswahl sollte auf weitere Zertifikate geachtet werden, etwa zur:
- PID-Beständigkeit
- Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse
- Beständigkeit gegen Salznebel, Ammoniak, Staub und Sand (z. B. IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068)
Neben Modulen sollten auch andere PV-Komponenten sorgfältig auf die Einhaltung relevanter Normen geprüft werden, darunter:
- NC RfG-Zertifikat – Bestätigt die Konformität der Wechselrichter mit Netzanschlussanforderungen.
- SN EN 50618:2015 – Norm für Kabel und Leitungen in PV-Systemen.
Elektrische Sicherheit
Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen bergen Risiken wie Stromschlag, Überspannung oder Kurzschluss. Zur Minimierung dieser Risiken sollten PV-Anlagen mit entsprechenden Schutzsystemen ausgestattet sein. Dazu gehören:
- DC-Sicherungen (Stufe I und II) zum Schutz vor Kurzschlüssen
- DC-Leistungsschalter zum Schutz der Verkabelung und Systemkomponenten
- Erdungssysteme zur Vermeidung von Stromschlägen
- Blitzschutzsysteme zum Schutz vor direkten Blitzeinschlägen
- Überspannungsschutz zur Sicherstellung der PV-Systemstabilität
Je nach Projektanforderungen kann diese Liste erweitert werden.
Konstruktive Aspekte
Europäische Vorschriften zur architektonischen Sicherheit bei der PV-Installation sind nicht präzise genug, sodass keine Verpflichtung zur statischen Dachanalyse besteht. Dennoch ist eine solche Analyse empfehlenswert. Berücksichtigt werden hierbei unter anderem:
- Konstruktionsrichtlinien
- Schneelast
- Windlast
- Stahlbeton-, Stahl- und Holzkonstruktionen
Das Gewicht der PV-Module, zusätzliche Ballastgewichte und extreme Wetterbedingungen können die Statik des Dachs beeinflussen.
Messungen und Betrieb
Nach der Installation müssen Messungen gemäß SN EN 60364-6 erfolgen. Hierzu gehören:
- Polaritatsprüfung
- Durchgangswiderstandsmessung
- Isolationsmessung der AC- und DC-Kabel
- Erdungswiderstandsmessung
- Kurzschluss- und Schutzleiterwiderstandsmessung
Ergänzende Tests wie Infrarot-Thermografie können durchgeführt werden. Nach der Installation sollte der Betreiber eine ausführliche Dokumentation erhalten, die Wartungshinweise und Sicherheitsrichtlinien enthält.
Mit diesen Maßnahmen lässt sich eine sichere und effiziente Nutzung von Photovoltaikanlagen in der Schweiz gewährleisten.